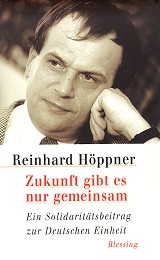
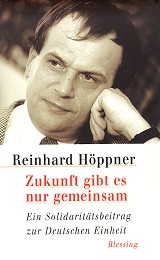 |
„... unsere Unterschiedlichkeit als gegenseitige Bereicherung erfahren ...“Reinhard Höppner: Zukunft gibt es nur gemeinsam |
Das hier zu besprechende Buch reiht sich in besonderer Weise in ein Literatur-Genre ein, das sich unter dem Stichwort „Vereinigungskritik“ wiederfindet. Daniela Dahns Vertreibung ins Paradies, Hans Misselwitz' Nicht länger mit dem Gesicht nach Westen, Fritz Vilmars (HG) Zehn Jahre Vereinigungspolitik. Kritische Bilanz und humane Alternative sind nur einige hier zu nennende Arbeiten zu diesem Themenkreis. Nach Manfred Stolpes Sieben Jahre, sieben Brücken. Ein Rückblick in die Zukunft offenbart sich nun auch Reinhard Höppner als sozialdemokratischer Ministerpräsident zu diesem wohl noch immer primär die Erfahrungs- bzw. Gefühlswelt der Menschen ansprechenden Thema. Seine Absicht sagt er frei heraus: Er möchte sorgsam gepflegte Feindbilder zerstören, und er wendet sich zugleich mutig gegen diejenigen, die der Versuchung erliegen, wieder neue Feindbilder aufzubauen. Statt dessen sollten die Unterschiede zwischen Ost und West als geschichtlich gewordene, als natürliche wahrgenommen werden, „damit sie nicht mehr trennend zwischen uns stehen“. Es müsse gelingen, „die größer gewordene Vielfalt als Bereicherung zu erfahren“. Er sucht den Widerspruch zu seinen Gedanken wie das reinigende Gewitter. Indessen werden sich ostdeutsche Leser eher im Konsens mit dem Autor auf die Suche nach der ostdeutschen Heimat und der ostdeutschen Identität begeben und dabei den Blick durch die bunte Erscheinungswelt wagen wollen. Höppner vermerkt kritisch, daß die „ein paar Jahre nach der Wende getroffene Einschätzung westdeutscher Politologen, Deutschland müsse sich mit der Vereinigung weder wirtschaftlich noch sozial noch politisch substanziell verändern, da in der DDR eine verwertbare eigene politische und kulturelle Substanz völlig“ gefehlt habe, „eine katastrophale und folgenreiche Fehleinschätzung“ gewesen sei. „Es wäre auch darum nötig, von der Bundesrepublik der ersten 40 Jahre als der ehemaligen Bundesrepublik zu sprechen, weil es die Westdeutschen zwingen würde, sich den Veränderungen wirklich zu stellen, und den Ostdeutschen die Chance gäbe, in dieser veränderten Bundesrepublik tatsächlich mit eigenem Profil, eigener Biographie und eigenen Hoffnungen und Zielvorstellungen anzukommen.“ Ebenso scharfsinnig ist seine Feststellung, wonach die „Geschichte der DDR für viele Westdeutsche Auslandsgeschichte, jedenfalls die Geschichte eines anderen Staates“ sei. Noch immer erinnere „der Stil mancher Fernsehberichte aus den ostdeutschen Bundesländern die Ostdeutschen an den Stil von Auslandsberichterstattung“. Man müsse schließlich akzeptieren, „daß sich in Ost und West in der Zeit der Trennung unterschiedliche Kulturen herausgebildet haben“. Ein Satz wie dieser lädt ein zum geistigen Verweilen: „Wem die eigene Geschichte ausradiert wird, der kommt sich heimatlos vor. Heimat ist auch der Ort der Erinnerung. Mag die Vergangenheit noch so schwer und zwiespältig gewesen sein, sie ist ein Stück von mir selbst. Sich erinnern gehört zur Würde des Menschen. Wem die Erinnerung genommen oder verzeichnet wird, dem nimmt man auch ein Stück seiner Würde. Und dabei geht es um mehr als um den Austausch persönlicher Erinnerungen.“ Höppner entwickelt kritische und mutige Gedanken, die den Leser in diese unwillkürlich einbindet, zum Verharren und Nachdenken „verführt“. Gelesenes verknüpft sich für den Ostdeutschen scheinbar unbemerkt mit eigener Erfahrung und eigene Sichten und führt so zur eigenen Identifizierung mit dem dargebotenen schwierigen Stoff jüngster Zeitgeschichte. Höppner erzählt kritisch Geschichte, als Humanist und zur Humanität auffordernd. Hier liegt wohl auch die Stärke, das Besondere dieses Buches. Höppner macht Mut zur Erinnerung, die Stationen deutscher Nachkriegsgeschichte sind kaum ohne das Wissen um menschliche Lebenswege, um Visionen mehrere Generationen denkbar.
Zuweilen werden historische Begebenheiten thesenhaft in Erinnerung gebracht: „Adenauer und Ulbricht verfolgten die Strategie ihrer jeweiligen Siegermächte. Sie taten dies beide allerdings nicht nur aufgrund von Vorgaben der Siegermächte, sondern auch aufgrund eigener Überzeugung.“ Im Osten habe das „Trauma von der gespaltenen Arbeiterklasse“ und das mit „Komintern-Mentalität der Kommunistischen Internationale“ gepflegte Klassenkampfdenken letztlich zur Ausschaltung und Verfolgung der Sozialdemokraten geführt, das antifaschistische Selbstverständnis der DDR sei für die Rechtfertigung sozialistischer Fehlentwicklungen instrumentalisiert worden. Als Signal deutscher Fehlentwicklung thematisiert der Autor die Ereignisse um den 17. Juni 1953. Er sagt, was heute bereits oftmals kaum noch erwähnt wird: Der Juni-Aufstand wurde von der sowjetischen Besatzungsmacht, von den Panzern der Sowjetarmee niedergeschlagen. Die DDR hatte zu dieser Zeit noch kein staatliches Souveränitätsrecht. Der erste Staatsvertrag zwischen DDR und UdSSR wurde 1955 geschlossen, aber erlangte die DDR jemals die völlige Souveränität? Höppner hinterfragt die Geschichte so weit nicht, aber er regt dazu an, weitergehende Fragen gedanklich zu formulieren. „Wir haben ja unter uns Ostdeutschen den Streit noch nicht ausgetragen, ob die DDR von Anfang an auch in ihrer Gesellschaftskonzeption der Ausfluß des totalitären Stalinismus war, oder ob sie wenigsten für einen Teil der politischen Klasse auch der redliche Versuch einer gerechteren Alternative zum Kapitalismus war. Ich neige zu der Einschätzung“, so der Autor, „daß sie auch der Versuch einer solchen Alternative war“. Höppner erinnert daran, „daß im Verlauf der deutsch-deutschen Geschichte auch viele Westdeutsche das so gesehen und gesagt haben. Sie waren aber offenbar nach dem Zusammenbruch der DDR sehr daran interessiert, solche früheren Einschätzungen schnell zu vergessen“. An Beispielen wird verdeutlicht, daß „Versuche, uns unsere Geschichte gegenseitig aufzurechnen“, nicht zur Versöhnung führen können.
Kritisch setzt sich der Autor mit der ideologisch programmierten Identitätsfindung in der DDR auseinander. Daß es zu diesem Thema sehr unterschiedliche Befindlichkeiten gibt, ist gewiß unstrittig. Für viele Menschen habe es vor der Wende keine DDR-Identität gegeben. „Die heute wahrnehmbare Ostidentität, die so aussieht wie eine nachträgliche Identifizierung mit der DDR, ist ein Produkt der Wende.“ Für die Identifizierung des Menschen mit einem Gemeinwesen nennt Höppner drei Kriterien: Schuld, Scham und Stolz. Überlegungen, die gerade für die so häufig aufkommenden nostalgischen Erinnerungen interessant sein dürften. In der gebotenen Kürze ist hier nur der „Stolz auf die DDR“ zu hinterfragen. Nach Höppner konnte man auf diesen Staat nicht stolz sein, und doch scheine es so, als würde uns Ostdeutsche ein gewisser Stolz jetzt zusammenführen. Dies sei aber nicht der nachträgliche Stolz auf den untergegangenen Staat, sondern „der Stolz auf die Lebensleistung der Menschen in der DDR, der jetzt möglich ist, nachdem es die DDR nicht mehr gibt“. Es sei der „Stolz, der wächst, wenn man ihn mit Füßen tritt, ein trotziger Stolz“. Es sei „der Stolz darauf, daß wir die schwierigen DDR-Verhältnisse gemeistert und diese Verhältnisse trotz aller Widrigkeiten gestaltet haben und sie schließlich verändern konnten. Es ist der Stolz auf Improvisationstalent und Lebenskunst, die auch die nach heutigen Maßstäben tristen Plattenbauwohnungen in Orte verwandeln konnten, an denen glückliches Leben möglich war.“
Indessen seien Versuche der DDR-Führung, dem Volk der DDR von oben eine Identität zu vermitteln, gescheitert. Höppner erinnert an die „sozialistische Menschengemeinschaft“, und der Leser wird sich ebenso an die „kommunistische Erziehung“ erinnern. In diesem Zusammenhang entwickelt Höppner auch interessante Begebenheiten im Umgang mit der Geschichte und den Traditionen. Anfang der achtziger Jahre habe die DDR-Führung erkannt, daß sich mit den Traditionen der Arbeiterbewegung allein kein Staat machen lasse. Man habe sich u. a. auch auf die preußische Geschichte besonnen, das Denkmal von Friedrich dem Großen wieder an seinen angestammten Platz Unter den Linden in Berlin gestellt. Biographien großer Deutscher durften geschrieben werden. Die Historiker seien „immer schon einen Schritt weiter“ gewesen, als die Zensur zuließ. Das Fernsehen der DDR habe seinen historischen Horizont mit Fernsehspielen und Filmen zur deutschen Geschichte erweitern können, „die auch wegen ihrer teils herausragenden künstlerischen Qualität von Millionen im Osten ernsthaft diskutiert wurden und zum Teil sogar Ausstrahlung im Westen fanden“.
Höppner nennt die Schwierigkeiten, die es in anderen Fragen gab, wie beispielsweise die Frage nach der Nation, die Stellung des Staates zu den Kirchen usw. Auch sei die Frage nach der DDR-Wirklichkeit mit all den Unterschieden in den einzelnen Jahrzehnten zu beantworten.
Letztlich findet Höppner ein Lösungsangebot: „Vielleicht müssen wir gar nicht ein Bild der DDR finden, sondern ein Bilderbuch der Toleranz, in dem jeder seine Perspektive entdecken kann, ohne die des anderen bestreiten oder gar verteufeln zu müssen.“
Nicht minder schwierig sind all die Fragen, die unmittelbar mit der Wende 1989/90 zusammenhängen. So nennt er ein Kapitel „Die Volkskammer als Laienspielschar oder: Warum der Übergang nicht ohne Improvisationstalent zu gestalten war“. Der größere Teil seiner historischen Rückschau ist „Zehn Jahre(n) Einheit“ gewidmet. Höppner sieht einen grundlegenden Fehler darin, daß nur auf die Geschichte der DDR geschaut wurde, obgleich DDR und ehemalige Bundesrepublik ganz eng zusammenhängen. Er glaube nicht, „daß man die Geschichte der DDR einigermaßen gründlich schreiben kann, ohne die Akten der Bundesrepublik Deutschland als Quelle neben die Akten der DDR zu legen“. Ein weiterer Fehler sei mit der Suche nach Schuldigen begangen worden. „Statt sich genau zu erinnern, werden Vorurteile und Verdächtigungen zu Verurteilungen. Die Gedächtnislosigkeit kommt im Mantel der Geschichtsbewältigung daher. Diese Art Aufarbeitung ist würdelos und verbaut unsere Zukunft, statt uns Zukunft zu öffnen. Was wir brauchen, ist ein genaues Erinnern, das die Quellen der Wahrheit vor allem auch über uns selbst freilegt.“ Selbstkritisch setzt sich Höppner mit der Stasi-Problematik auseinander. „Wir haben damals manchen Unrecht getan. Längst wurde die Vergangenheit einschließlich der Akten instrumentalisiert im Kampf um Macht und Einfluß im neuen Deutschland - nicht nur auf der politischen Bühne.“ Aus der Sicht der geschichtlichen Beurteilung einer historischen Epoche sei die auch gegebene positive Leistung in den Hintergrund getreten. Das Bild von der DDR sei vor allem durch den Rückgriff auf die Stasi-Akten verzerrt worden. Ausführlich befaßt sich Höppner mit dem Zusammenhang von sozialer Frage und Selbstbewußtsein, mit der Frage, warum Ostdeutsche sich noch immer als Deutsche zweiter Klasse fühlen? Schon 1997 haben 80 Prozent der Ostdeutschen das Gefühl des Zurückgesetztseins. Ebenso kritisch wird das Problem der Rentenkürzung wegen „Systemnähe“ beleuchtet. Im letzten Kapitel widmet sich Höppner der gemeinsamen Zukunft. Der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, und hier dürfte der Autor wahrscheinlich auch auf Widerspruch eines Teils seiner Leser stoßen, wird als Ende einer gesellschaftlichen Utopie charakterisiert. Er sei „das Ergebnis globaler, vor allem wirtschaftlicher Veränderungen auf unserer Erde“ gewesen. „Der Zusammenbruch des Ostblocks“ habe „seinen Grund nicht nur in der Reformunfähigkeit des sozialistischen Systems“ gefunden, er sei „auch der Vorbote einer neuen Zeit“. Sein Zauberwort: „Globalisierung“. Er sei sicher, „die Welt wird sich im neuen Jahrhundert radikal verändern“.
Alles in allem ein sehr interessantes Buch, das nicht nur zum Mit- und Weiterdenken anregt. Reinhard Höppners Überlegungen sind auf Objektivität im Umgang mit Geschichte, auf die Achtung der menschlichen Würde und auf die Zukunft orientiert. Seine offene und sachliche Art, die Dinge beim Namen zu nennen, kann die weitere Diskussion und das Handeln befruchten, wenn die Welt so gesehen wird, wie sie wirklich ist.