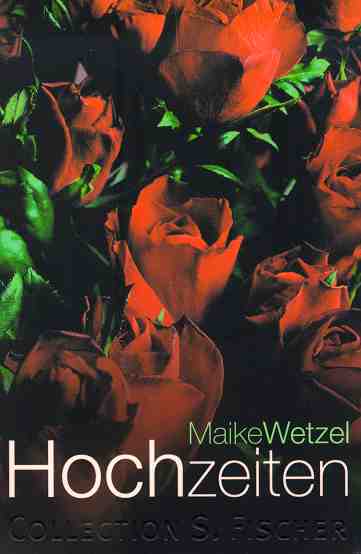Eine Rezension von Burga Kalinowski
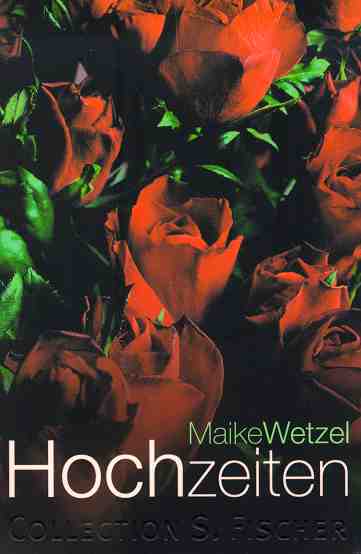 |
Woran das Herz so hängt,
woran der Kopf so denkt -
und dann in Bücher drängt
Alexa Hennig von Lange/Till Müller-Klug/Daniel Haaksman:
Mai 3 D. Ein Tagebuchroman.
Quadriga/Econ Ullstein List Verlag, München 2000, 199 S.
Jana Simon/Frank Rothe/Wiete Andrasch (Hrsg.): Das Buch der
Un-
terschiede. Warum die Einheit keine ist.
Aufbau-Verlag, Berlin 2000, 237 S.
Alexa Hennig von Lange: Ich bin's
Rogner & Bernhard bei Zweitausendeins, Frankfurt/M. 2000, 209 S.
Maike Wetzel: Hochzeiten
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M. 2000, 128 S. |
Es ist schön, wenn sich immer wieder Belege dafür finden, daß junge Menschen des
Lesens und des Schreibens kundig sind, und diese Fähigkeiten in Kombination mit
Mitteilungsbedürfnis und missionarischen, aufklärerischen, informativen, merkantilen oder
unterhaltenden Impuls anwenden. Das Ergebnis ist ein oft auch Buch genanntes
Produkt. Seit einiger Zeit bricht eine Welle von Gedrucktem aus junger Feder über den Markt
herein, daß es nur so rauscht. „Junge Literatur“ ist keine Stilbezeichnung, ermöglicht
aber erste Zuordnung. Das ist aus Übersichtsgründen einerseits gut, andererseits fatal,
weil selbst die einfachste Benennung eine Erwartung produziert. Das führt mitunter zu
Mißverständnissen, wenn nicht zu herber Enttäuschung. Es ist eine Frage des Maßstabs.
Und genau das ist ein Problem: der Maßstab. Sowohl der der Autoren und der von ihnen
ins Rennen geschickten Figuren, als auch der des Lesers. Drei eher unbekannte Größen,
die im Vorgang des Lesens aufeinandertreffen und je nach Grad der Übereinstimmung
Akzeptanz, Ablehnung oder Langeweile bewirken. Nun wird kein Mensch von einem
Büchlein über Mitzwanziger von heute und über ihr schweres leichtes Leben einen
Tauchgang in den Marianengraben existentieller Fragen erwarten, wohl aber mehr als einen
Husch durch zwei, drei Berliner Kneipen, Stehpartys und Modelagenturen mit
standardisierten Events.
Einfach haben sie es ja nicht, diese Jungmenschen, Werbepostern für das hippe
Berliner Leben nachgeschneidert. Im Erlebnispark für Selbstverwirklicher ist einiges los:
schlafen, aufstehen, ein bißchen lesen, fernsehen, in den Spiegel gucken, abends ausgehen, mit
Leuten rumlabern, nachts ins Bett gehen, Nummer schieben. Schlafen, aufstehen ... usw.
Ach ja, telefonieren noch, Faxe schreiben, E-Mails lesen, Darm entleeren, zum
Kollwitzplatz gehen, Jointreste aus den Gesichtsmuskeln schlagen, neue Partys aufreißen. „Peng -
schon wieder Abend“, stellt David, der DJ, erstaunt fest und beschließt, vor die Tür zu gehen
- ein bißchen Spaß muß sein. Er, Marc und Kai schlagen sich nach dem Willen der
Autoren einen Monat lang durch Raum und Zeit und notieren den Kram minutiös.
Tagebuchroman heißt das dann und dreidimensionale Pop-Soap -
Mai 3 D eben.
Gibt's das wirklich, ist Leben so - öde? Oder sieht man das nur falsch? Mögen die
Jungen das vielleicht? Oder wollten die Autoren mal eben schnell 'n Buch schreiben? Fix
werden drei Figuren aus dem Legokasten der Selbstbespiegelung synthetisiert und auf
den Kalendertrip geschickt. Dröge wie Stubenfliegen taumeln sie von Tag zu Tag.
Beschreiben unerhebliche Befindlichkeiten - fast alles nur Reflexe auf sich selbst: mentales
Aufstoßen. Wortpupserei. Kaum, daß ein Hauch Wirklichkeit unter die Käseglocke dringt.
Aber immerhin, es kommt vor: als verschlampte Diplomarbeit, als Gerichtsvollzieher, als
unverhoffte Vaterschaft oder als Zudröhnen mit Billig-Pillen.
„Schrecklicher kann es nicht mehr werden. Das ist tröstlich. Und ein bißchen so geht
es mir. Ich habe die dunkle Nebelwand hinter mir gelassen. Die ersten Sonnenstrahlen
brechen zu mir durch.“ So liest es sich, wenn ein 24jähriger über sein Leben sinniert.
Und die Vermutung ist nicht mehr zu verdrängen, daß es der Leser hier möglicherweise
mit der Gefühls- und Gedankenwelt des Autoren-Trios zu tun hat, das in einer
buntgestrichenen Isolierzelle festsitzt und sich zuquatscht. Was ja zur Not noch ginge,
wenn es nicht so steril wäre, so erschreckend schal und phantasielos bis in die Sprache
hinein. Groschenromane sind wahrscheinlich konfliktreicher, haben mehr Biß.
Keine der Figuren, kaum eine ihrer „Geschichten“ und schon gar nicht ein Gedanke
gewinnen Eigenständigkeit. Die jugendlichen Glücksritter bleiben ohne Konturen. Nix mit
3 D. Dem ersten Satz des Buches ist vorbehaltlos zuzustimmen: „Irgendwie bin ich
gelangweilt.“
Daß Langeweile nicht schicksalhaft an Texte von jungen Schreibern gebunden ist,
belegt u. a. Das Buch der Unterschiede, eine Sammlung von Erlebnissen und Erfahrungen mit
der Einheit, die eben keine ist. 23 junge Leute aus Ost und West machen sich unbefangen
über Deutschlands feinste Politemotion her. Frei von der ideologischen Attitüde ihrer
Elterngeneration, gucken sie auf ihre Herkunft, machen sich ein wenig lustig über die
jeweils genossene Kinderstube, akzeptieren, daß andere anders sind, und amüsieren sich
über die Langzeitwirkung von Vorurteilen auf beiden Seiten. Charme, Authentizität und
Witz der meisten Texte bestehen darin, daß die Autoren keinerlei Sinn für themenübliches
Pathos entwickeln und sich strikt allgemeinem Befindlichkeitsgeraune verweigern, was
immer wieder eine Wohltat ist. Sie bleiben auf dem Boden ihrer Tatsachen, der
vergangenen sowie jetziger. Keine(r) ist heute älter als 37, zwei waren 1990 16, einer 14 Jahre alt.
12 sind journalistisch tätig, was aber nicht schadet. Alle Texte sind persönlich, sollten es -
so die Idee zum Buch - auch unbedingt sein: der geschichtliche Vorgang nicht als
Historienschinken, sondern in der kleinen individuellen Skizze reflektiert.
Auf diese Weise ist ein Kaleidoskop der Erinnerung entstanden, das auch ein Zeitbild
zeichnet, selbst wenn manche Erfahrung und daraus resultierende Sichten
möglicherweise nicht mit denen aller Leser übereinstimmen. So ist das mit den Unterschieden, von
denen David Wagner (geb. 1971) in seinem Beitrag „Meine Cousine und ich. Vom Neid
auf den Umsturz der anderen“ vermutet, daß sie „irgendwo in den Erinnerungsräumen
liegen“ müssen. Ostler haben dann weiße Flecken da, wo beim Westler der
„Glaubenskrieg Adidas gegen Puma“ tobte. „Ostler können nicht Zornflakes sagen, weil sie nie Corn
Flakes essen konnten. (...) Im Osten gibt es keine älteren Nutella-Kinder. Ostler haben kein
Markenleben geführt.“ Wagner macht daraus keinen Vorwurf, aber er weiß und weist darauf
hin, daß dies alles einen beträchtlichen Wiedererkennungswert hat, der Nestwärme und
stillschweigende Allianzen befördert. So kommt es, „daß Ostdeutsche sich kaum an den
Statusspielchen der Westdeutschen beteiligen können. (...) Bei mir war es so oder so, sagt
der eine. Bei mir war es ein bißchen anders, müßte der Ostdeutsche sagen.“ Und sollte
ungeniert seinen eigenen Erinnerungscode benutzen. Davon versteht der Westdeutsche
herzlich wenig und sieht seinerseits ziemlich alt aus. Aber der Osten hat ihn ohnehin nie
richtig interessiert ... „Ostdeutsche kamen bei uns lange nicht vor. Wahrscheinlich wußte
ich als Schüler auch mehr über die Römer und das Leben im Rom der frühen Kaiserzeit
als über die Bewohner der DDR.“ Dann toppen die Ostler die Westler: Sie schaffen ihr
Land ab, gewissermaßen, während „Westdeutschland, die feiste Bundesrepublik, viel leiser,
ohne Knall und Fall und ohne emblematisches Datum zu Ende (ging). Ich beneidete die
andere Seite, die von drüben, für die auf einmal alles anders war. Ich beneidete sie um den
Verlust und den deutlichen Bruch, mit dem sie plötzlich alles los wurden, überall diese
kindischen, komischen Parolen abschraubten und ihre alten weißhaarigen Oberhäuptlinge
nach Südamerika verjagten.“ Während bei ihm (Wagner) nicht viel passierte, außer, daß die
„Farbe der Snickers-Verpackung von Rot zu Braun“ wechselte, und aus einem Süßriegel
mit dem Namen Raider wurde Twix. Zugegeben, ein wenig wenig Veränderung.
Stillstand. Diesen Vorwurf macht auch das schreibende Ost-Mädchen Jana Simon (geb. 1972)
ihrer ehemaligen Gesellschaft. Sie empfand „die DDR als trist, grau und langweilig. Sie
verbreitete ein Lebensgefühl, das von permanenter Melancholie, Desillusionierung, absolutem
Stillstand und der Gewißheit, von der Welt abgeschnitten zu sein, geprägt war - alles
Eigenschaften, mit denen ich mich nicht identifizieren mochte. Mein Land konnte mir
nichts mehr bieten, woran es sich lohnte zu glauben. Also glaubte ich an das Fernsehbild, an
die Tagesschausprecherin und an Formel Eins mit Ingolf Lück. Lange vor dem Mauerfall
war ich der DDR weggelaufen. Sie hatte es nur nicht bemerkt.“ Jana Simon beschreibt die
Strategie der inneren Emigration und die Rolle der West-Medien dabei. Die Gegend hinter
der Mauer war das Land nicht nur ihrer Träume. „Ich bewegte mich in einer Art
virtuellen Welt. Meinen Geschmack, meine Kleidung und Musik definierte ich über den
Westen, meinen Alltag verbrachte ich im Osten. Ein höchst schizophrener Zustand.“ Dann
kam der Westen über den Osten und die 18jährige überall hin, u. a. problemlos zu ihrem
Freund in Österreich. Eine Ost-West-Beziehung mit entsprechenden Tücken: Sie erlebt
bürgerlich-spießige Familienwelt mit katholischem Einschlag und denkt erstmalig ein DDR-Wir
(„da sind wir fortschrittlicher“), er sieht, peinlich berührt, ein konsumsüchtiges Ost-Girlie.
Die Werteskalen sind kaum kompatibel. Ostherkunft nach wie vor ein Sonderstatus, von
dem die Autorin aus eigener Erfahrung weiß: „Erst durch das Bemerken meiner
Andersartigkeit ist für mich im nachhinein so etwas wie eine Ostidentität entstanden.“ Manchmal
sei das sogar ein Vorteil. Vor allem im Osten.
Das Buch der Unterschiede ist eine uneitle Vermittlung unterschiedlich erlebter
Wirklichkeit, bemerkenswert vor allem darin, daß keine Ego-Psycho-Mätzchen
bedeutungsschwer präsentiert werden, sondern ganz einfach beschrieben wird, wie „Ich“ auf „Welt“ trifft
und was dann so passiert. Das ist allemal spannender als pure Nabelschau.
Natürlich schreibt „jung“ zuerst über sich selbst, über seine Milieus, seine
zeitgemäßen Irrungen und Wirrungen, über Süchte, Lust und Leiden, Ängste, Schmerz und
Aggressionen - über Hoffnungen und Hoffnungslosigkeiten. In den glücklichen Fällen der
Literaturgeschichte wie Goethes Leiden des jungen
W. (geschrieben mit 25 Jahren), die Buddenbrocks von Thomas Mann (26 Jahre) oder Borcherts ( 26 Jahre)
Draußen vor der Tür erhält eine Generation oder ein Zeitenbruch oder ein Sinn-Riß ein gültiges Bild.
Im Schnittpunkt von Ich-Befindlichkeit und Zeitgeist können Panoramen entstehen.
Meistens gelingt ein Ausschnitt, oder - bescheidener - ein Splitter, manches Mal
freilich langt es grad zu einem Blick (durchs Schlüsselloch) in die eigene gute Stube oder
bestenfalls in die des Nachbarn.
Nun aber zur Sache, also zum zweiten Buch von Alexa Hennig von Lange. Nach
ihrem Romandebüt Relax legte sie sofort nach mit
Ich bin's (nicht zu vergessen die Mitautorenschaft beim kollektiven
Mai 3 D) - feuern, was das Zeug hält. Schreibt sie eigentlich
noch die bewegenden Storys für „Gute Zeiten - schlechte Zeiten“? Egal, hier geht es um
„Ich bin's“. Leicht verschreckt von „Mai 3 D“, ehrlich gesagt auch von der Mitwirkung an „GZ - SZ“, drückte ich das Buch meiner knapp 20jährigen Tochter in die Hand. Soll
sie die „Einblicke in die Anfechtungen eines Heranwachsenden“ lesen, die zudem in der
„angesagten Sprache seiner Generation“ verfaßt sind, wie die „Welt“ feststellte. Dem
„beeindruckenden Psychoporträt“ fand ich, sollte Beurteilungsgerechtigkeit widerfahren:
Leserin, Buchheld, Autorin gewissermaßen auf gleicher Augenhöhe - der kleinste
gemeinsame Nenner ihre Jugend und Kenntnis des Milieus. Was schon so'ne Frage ist, welches
Milieu? Und: Gibt es überhaupt „die“ Sprache einer Generation, wenn Sprache als der direkte
Ausdruck von Denken vorausgesetzt wird? Mal sehen.
Mama, sagte meine Tochter, das ist nichts für dich. Und für dich? Schulterzucken. Sie
kenne keinen, der soo ist, lebt, spricht. Es könne aber sein, daß es solche Leute gibt,
Freaks eben. Ist okay, aber nicht ihr Ding, sagt die Generationsgenossin des Helden Lars und
bietet eine Vermutung an: Vielleicht denkt die (gemeint ist die Autorin), daß sie Ahnung
hat, vielleicht, daß sie cool und trendy ist, vielleicht, daß sie 'ne ganz Schlaue ist und sich
total auskennt. Na und, warum nicht, wenn sie das braucht. Jedenfalls greife sie direkt ins
denkbar Schlechteste rein. Voll das Schlimme. Lars lebt eigentlich ein Scheißleben, spinnt
sich aus dem Müll verschiedener Fernsehserien Gegenwelten, die er seinen jeweiligen
realen Situationen überstülpt und in denen er der tragische, strahlende, siegende -
jedenfalls immer Held ist. Sonst hat er nicht viel. Sein Herz hängt an Airmax von Nike -
Turnschuhe sind die Highlights seiner Gefühle. Das solle wohl 'ne Metapher für Sehnsucht
nach Geborgenheit und Sicherheit sein. Ist doch traurig, sagt mein Kind, und irgendwie
unnormal. Auch die Geschichten, die Lars mit seiner Freundin Mia und der Nachbarin Lilly
habe, sind krass, obwohl das Hin und Her, ja, das könnte sein und hätte stellenweise sogar
Komik. Ziemlich wirr, aber so was kommt vor. Trotzdem wirkt das alles ausgesprochen
hysterisch, abgedreht. Und total abgefahren sind die Sexkisten. Dauernd Sexphantasien,
echt extrem. Selbst für Jungs, aber dieser Lars stehe ja ständig unter Strom, „hat der nichts
zu tun, keine Arbeit? Wovon bezahlt der seine Wohnung? Das erfährt man nicht. Find
ich hohl.“ Und die „angesagte“ Sprache, so ordinär und vulgär, so was habe sie noch nie
gehört. Außerdem erzählt der Typ alles als Monolog, und das wird mit der Zeit ziemlich
öde, also monoton, und da würde man eben merken, daß sich einer die schnoddrige
Sprache ausgedacht hat und so tut, als ob. Wenn ein 20jähriger nur so kindisch denkt und
redet, dann tickt der nicht richtig. Aber ich solle mich freuen, paar Sachen fände sie auch
gut. Manche Situationen sind anschaulich beschrieben und stimmen in der Beobachtung.
Zum Beispiel Geschichten aus der Kindheit von Lars, oder als er sich auf einem Parkplatz
in einen LKW verkriecht und nicht klarkommt damit, daß Mia, seine Freundin, mit
ihm Schluß gemacht hat. Meine Tochter blättert die Stelle auf - „blödes Ende! Was macht
man denn, wenn man verlassen worden ist? Keine Ahnung. Ich wurde noch nie verlassen.
Am besten man tut so, als ob einem alles egal ist, und latscht ein bißchen durch die
Straßen und sucht eine Würstchenbude. Schließlich muß man irgendwie das Loch stopfen,
was einem durch die Trennung ins Herz gerissen worden ist.“ Dann merkt sie, daß das
Bild nicht stimmt (ein Herz, in dem eine Bratwurst steckt), aber die Stimmung sei getroffen.
Letzte Frage: Fällt dir bei diesem Buch Peter
Camenzind oder Der Fänger im Roggen ein? - Nein, natürlich nicht. Also Mama, das ist doch Literatur!
Der spontane Ausschluß von „Ich bin's“ aus dem Land der Literatur - im Gegensatz
zu zwei Klassikern des Entwicklungsromans -, dieses schnelle Urteil führt trotz
seiner Schlichtheit (oder gerade deswegen?) wieder zu der Frage nach dem Maßstab.
Offensichtlich gibt es maßgebliche Kriterien, die unterschwellig wirken und in ihrer Gesamtheit
beim Durchschnittsleser eine Art rezeptives System bilden - Signalgeber für erste
Zustimmung oder Ablehnung. Schwafelnde, nach dem saisonalen Hype gestylte Texte sind bei aller
eloquenten PR am Ende doch nur Schwalben eines Feuilleton-Sommers.
Dagegen sind „Hochzeiten ein kleines Stück Literatur mit Widerhaken“, meint ein
Rezensent zu den Erzählungen von Maike Wetzel. Auch eine Junge, 1997, mit 23 Jahren,
jüngste Preisträgerin des Bettina-von-Arnim-Preises, Stipendiatin beim Klagenfurter
Literaturkurs, 1999 der Allegra-Literaturpreis. Sie war 20 Jahre, als sie den Lesbe-Literaturpreis für
die Erzählung „Nachsaison“ bekam, die jetzt mit anderen Geschichten im Debütband
steht. Frühe Lorbeeren also für die Anfänge einer Anfängerin. Ein Schreib-Beginn, von dem
sich zumindest sagen läßt, daß er auffällig anders ist (oder so wirkt) als die Debüts vieler
anderer junger Autoren.
MaikeWetzel hält Distanz - zum Leser und zu ihren Figuren. Das Erzähler-Ich läßt
keine simple autobiographische Vermutung zu. Es gibt weder geschwätzige Intimität noch
gelassen gewährte Einblicke ins Eigene. Keine Botschaften. Keine Aufregung. Das geht bis
in die sprachliche Gestaltung, nein, das wird durch Sprache bewirkt. Die ist kühl,
bewußt, minimalistisch. Sorgsam, fast geizig, nimmt Heike Wetzel aus dem Fonds der Worte
die ihr passenden - grad so, als hätten sie Inflation und das, was sie ausdrücken, ebenfalls.
So ist es ja auch. Durch marktschreierische mediale Verwertung werden
Bedeutungsdifferenziertheit und Wirkungsvielfalt der Sprache auf Null gefahren. Worte sind
beliebig. Dem Totentanz der Wörter begegnet Maike Wetzel mit kalkuliertem,
ökonomischem Umgang, gibt ihnen so ihre Bedeutung zurück und denen mit ihnen gefügten
Geschichten einen Subtext, in dem vage Andeutungen schwingen: Abgründiges im Vertrauten
(„Der König“), ungewisse Gewißheiten einer lesbischen Beziehung („Nachsaison“),
angstflackernder Glanz einer Todkranken („Lou“), schwangerschaftsstiftende und wortlose
Teilhaberschaft der Tochter am Geliebten der Mutter („Hochzeiten“). Maike Wetzel
skizziert Beziehungen und Situationen. Es gibt keine Gefühle, keine Erklärungen, keine
Leserführung. Sie offeriert Angebote, die weitergedacht werden können - Ist-Zustände der
Alltäglichkeit, in denen man sich bewegen kann. Phantasieräume, die der Leser selbst
gestaltet - wenn er das will. „Der Blick ist entscheidend. Du mußt dich konzentrieren,
deine Augen festhalten, alles andere ausblenden, dann wird dir nicht schlecht. Du siehst die
Welt hinter den Dingen“ - so lautet eine Ich-Erfahrung in der sonderbaren Story einer
Flucht aus dem unveränderlichen Koma der Realität in die Surrealität der „Insel“ inmitten
eines Meeres aus Autowracks. Das Nicht- Mitgeteilte ist die Geschichte. Diese konsequente
Verweigerung von Story-Line führt zu einer hochkonzentrierten Gestaltung und hat
durch die Sujetwahl etwas von einem Experiment, etwa eines Insektenforschers, der seine
auf Nadeln gespießte Objekte mit sachlichem Interesse beobachtet.
Von Stil zu sprechen wäre verfrüht - als Schreibvariation könnte es interessant (nicht
neu) sein, wenn die Welt hinter den Worten (Dingen) nicht nur intelligent vermutet,
sondern auch mal sinnlich erkennbar wird. Kunstvoll oder künstlich, darüber läßt sich ebenso
streiten wie über die Möglichkeit, ob und daß die minimalistische Machart sehr schnell
zur Manieriertheit mutieren kann. Der vorliegende Erzählband allerdings rechtfertigt
einen solchen Befund nicht.
Die übliche Floskel anläßlich eines literarischen Debüts ist hier ernst gemeint: Man
darf gespannt sein auf die nächste Arbeit der Autorin.
Berliner LeseZeichen, Ausgabe 10/00 (c) Edition Luisenstadt, 2000
www.berliner-lesezeichen.de
 zurück zur vorherigen Seite
zurück zur vorherigen Seite